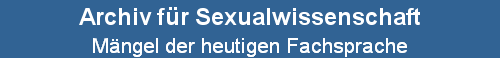|
|
||||||||
|
|
8.1.2 Mängel der heutigen Fachsprache
Wie man sieht, stehen hier vier typisch männliche drei typisch weiblichen Sexualstörungen gegenüber. In der Tat, wenn wir nur die Orgasmusphase der sexuellen Reaktion betrachten, ist der Kontrast noch größer: auf der einen Seite drei männliche, auf der anderen Seite nur eine einzige weibliche Funktionsstörung. Bei näherer Betrachtung erweist sich allerdings, dass hier kaum tatsächliche physiologische oder psychologische Unterschiede, sondern einfach vom The-rapeuten willkürlich falsch gesetzte begriffliche Akzente vorliegen. Der einzige echte Unterschied betrifft den Vaginismus (also den unwillkürlichen Scheidenkrampf), für den es beim Mann kein Äquivalent gibt. Der Vaginismus ist in diesem Sinne eine ausschließlich weibliche Funktionsstörung. Was hier aber beim Mann „Erektionsstörung" und bei der Frau „Erregungsstörung" heißt, bezeichnet im Grunde ein identisches Phänomen: mangelnde Blutfülle und damit fehlendes Steifwerden (Tumeszenz) der Geschlechtsorgane. Man könnte daher ebensogut auch von einer Erregungsstörung des Mannes sprechen, wenn das Wort „Erregung" nicht ohnehin - auch bei der Frau -unzulänglich wäre. „Erregung" kann auch ein rein psychisches Verlangen und Drängen meinen, das durchaus ohne jede körperliche Veränderung auftreten kann. In der Tat kennt fast jeder solche Momente, in denen „der Geist willig, das Fleisch aber schwach" ist. In einem solchen Fall fehlenden Anschwellens der Geschlechtsorgane bleibt bei der Frau auch die Bildung des Feuchtigkeitsfilms in der Scheide aus, und so kann ein dennoch begonnener Koitus schmerzhaft sein. Dieses Erlebnis wird dann von Therapeuten gewöhnlich als „Dyspareunie" oder „Algopareunie" in eine eigene diagnostische Kategorie abgeschoben, die auch viele andere, logisch unverbundene, ätiologisch völlig verschiedene Schmerzerfahrungen enthält. Wenn man bei Störungen der sexuellen „Erregungsphase" also eine vernünftige Einheitlichkeit herstellen will, sollte man wenigstens von fehlender körperlicher Erregung bei Mann oder Frau sprechen. Wenden wir nun unseren kritischen Blick auf die „Orgasmusphase" der sexuellen Reaktion, so erkennen wir, dass es sich nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann um „Orgasmusschwierigkeiten" (nicht um Ejakulationsschwierigkeiten) handelt. Tatsächlich sind in den Begriffen „vorzeitige Ejakulation" und „ausbleibende Ejakulation" (einige Autoren sprechen auch noch von einer „verzögerten Ejakulation") gleich mehrere Fehlvorstellungen miteinander verschmolzen. Zunächst muss man feststellen, dass hier unzulässigerweise Ejakulation mit Orgasmus gleichgesetzt wird. Das Problem bei der „vorzeitigen Ejakulation" ist eben nicht die Ejakulation, sondern der Orgasmus, den man gerne aufgeschoben hätte, weil er - wie schon im alten Griechenland - für die meisten Männer das Ende des Geschlechtsverkehrs bedeutet und deshalb die Frauen unbefriedigt läßt. Das hat aber an sich nichts mit dem Erscheinen oder Nichterscheinen einer Samenflüssigkeit zu tun. Eine Ejakulation ist normalerweise das Resultat oder Nebenprodukt des männlichen Orgasmus, muss es aber nicht sein. Es handelt sich um völlig verschiedene und oft voneinander unabhängige Vorgänge (zum Beispiel beim vorpubertären Orgasmus). Das wird noch deutlicher, wenn man daran denkt, dass auch manche Frauen als Resultat ihres Orgasmus ejakulieren, und zwar aus der Urethra, eine „prostatische", von paraurethralen Drüsen abgesonderte Flüssigkeit. Ob oder wann beim Mann ein Samenerguss erfolgt, ist deshalb irrelevant für die Diagnose der Störung, die eben darin besteht, dass er seinen Orgasmus früher oder später erreicht, als ihm lieb ist. Das gleiche gilt für das völlige Ausbleiben des Orgasmus; auch hier ist die Ejakulation Nebensache (es sei denn, die Partnerin will schwanger werden). Kurz gesagt, die angeblichen Ejakulationsstörungen sind genaugenommen „männliche Orgasmusstörungen". Diese Kritik ist aber noch relativ unwichtig im Vergleich zu einem grundsätzlichen Einwand, den man gegen den Begriff der „Vorzeitigkeit" als einer Störung der Ejakulation, oder richtiger gesagt, des Orgasmus erheben muss: Der Orgasmus selbst ist durchaus nicht gestört, wenn einem der Zeitpunkt seines Eintretens nicht passt. Das Problem liegt hier nicht in der sexuellen Reaktionsphase, die, an sich ungestört, physiologisch vollständig abläuft, sondern in der subjektiven Bewertung, ob diese Phase im Interesse einer sexuellen Begegnung „zeitlich richtig" stattfindet. Deshalb gibt es auch keinen „vorzeitigen" oder „verzögerten" Orgasmus bei einem einsamen Masturbierenden. Das Problem kann überhaupt nur entstehen, wenn ein zweiter Mensch als Sexualpartner hinzukommt. Erst dann kann der Eintritt des Orgasmus von dem ersten oder zweiten oder von beiden Menschen als zeitlich unpassend empfunden werden. Im Englischen lässt sich dieses Problem einfach und direkt als „unsatisfactory timing of orgasm" bezeichnen. Leider ist dieser Ausdruck aber nicht leicht zu verdeutschen, da es keine deutsche Entsprechung des englischen „timing" gibt. Vielleicht könnte man provisorisch von einer „unbefriedigenden Kontrolle über den Zeitpunkt des Orgasmus" sprechen, Auf jeden Fall muss man sich darüber klar sein, dass der Orgasmus selbst grundsätzlich nicht kontrollierbar ist. Nur der Zeitpunkt seines Eintretens kann, in gewissen Grenzen, bewusst gesteuert werden. Die Fähigkeit zu einer solchen Steuerung kann oft therapeutisch gestärkt, anerzogen oder wiederhergestellt werden. Hat man sich diesen, im Grunde einfachen Sachverhalt einmal klargemacht, dann erkennt man, dass solche Ausdrücke wie die von Masters und Johnson oder Heien Singer Kaplan benutzten „ejaculatory incompetence", „inadequate ejaculatory control" und „ejaculatory overcontrol" aus einem doppelten Grunde völlig an der Sache vorbeizielen. Hält man sich statt dessen an das einzig sichere Kriterium, an die Tatsache nämlich, dass von einem Paar der Zeitpunkt eines Orgasmus als unbefriedigend empfunden wird, so versteht man sofort den subjektiven Charakter des Problems. Die nächste Frage ist dann völlig logisch: „Unbefriedigend für wen?", und die Antwort darauf bestimmt dann den nächsten therapeutischen Schritt. Dieses Verfahren hat außerdem noch den Vorteil, dass es fallspezifisch bleibt und nicht zur Aufstellung universaler Normen oder Leistungsvorbilder für „funktionsgerechten" Geschlechtsverkehr führt. Solche Normen erwecken zwar den Eindruck objektiver Wissenschaftlichkeit, sind aber im Grunde willkürlich und auf jeden Fall therapeutisch schädlich. Schließlich können doch dieselben Menschen in anderen Partnerkombinationen sexuell völlig anders reagieren. Und noch ein letzter Punkt: Wenn man sich therapeutisch auf eine befriedigende Steuerung des Orgasmuszeitpunktes konzentriert, macht man damit klar, dass man eine Zweierbeziehung behandelt, man braucht die Patienten nicht mit einem negativen Etikett wie „Orgasmusstörung" zu deprimieren und hat allein dadurch schon die Therapie abgekürzt. Was nun die eigentlichen Ejakulations- und Orgasmusstörungen angeht, so bleibt davon die folgende Liste: Die Ausdrücke „retrograde Ejakulation" (ejaculatio retrograda) und „fehlende Ejakulation" (ejaculatio deficiens) bezeichnen sehr richtig objektive Störungen beim Vorgang der Samenentleerung. Die Ausdrücke „Anorgasmie" und „situative Anorgasmie" bezeichnen sehr richtig das objektive Ausbleiben eines Orgasmus. Ein eingetretener Orgasmus dagegen, dessen Zeitpunkt ein Paar oder ein Individuum subjektiv nicht befriedigt, ist, genaugenommen, nicht in sich selbst gestört. Im Interesse wissenschaftlicher Klarheit sollte man deshalb besser von einer „unbefriedigenden Kontrolle über den Orgasmuszeitpunkt" sprechen. Die dritte angeblich typisch männliche Störung, die der deutsche Text erwähnt, die „Ejakulation ohne Orgasmus" ist - wörtlich genommen - eine physiologische Unmöglichkeit. (Das Umgekehrte ist sehr wohl möglich.) So ist es aber nicht gemeint, denn die Erläuterung versteht darunter einen „Samenerguss ohne Lust- und Orgasmusgefühl". Dieser „lustlose Orgasmus" kommt aber auch bei Frauen vor. Was endlich die grobe Einteilung männlicher und weiblicher sexueller Funktionsstörungen betrifft, so lässt sich das eingangs erwähnte Schema folgendermaßen korrigieren:
Hinzu kommen natürlich noch einige Störungen, die man von jeher bei beiden Geschlechtern gefunden hat: sexuelle Aversion, Alibidinie, Algopareunie (wenn man schon bei diesen unpräzisen Sammelnamen bleiben will) und nachorgastische Verstimmungen. Ideologische Verfärbung Der oben zitierte deutsche Text (wie übrigens auch seine amerikanischen Vorbilder) diskutiert alle Sexualstörungen ausschließlich in bezug auf den „Geschlechtsverkehr", und was damit gemeint ist zeigt ein erläuternder Satz: „Schematisierend lassen sich fünf Phasen der sexuellen Interaktion zweier Partner unterscheiden: Annäherung, Stimulation, Einführung des Penis und Koitus, Orgasmus und nachorgastische Phase." Ganz abgesehen davon, dass diese Beschreibung niemals auf homosexuelle Partner passt (und auch diese brauchen manchmal Sexualtherapie), ist sie auch unzureichend für viele heterosexuelle Paare. Schließlich spielt bei manchen wegen körperlicher Behinderung (zum Beispiel Querschnittslähmung), aber auch aus anderen Gründen der Koitus keine Rolle, obwohl sie sonst durchaus eine befriedigende sexuelle Interaktion, also „Geschlechtsverkehr" haben. Das Wort „Geschlechtsverkehr" kurzerhand mit Koitus gleichzusetzen ist mehr als eine sprachliche Untugend, es verrät ein beschränktes Verständnis der möglichen Vielfalt menschlicher Sexualbeziehungen. Durch diesen Missbrauch wird jedoch die herrschende unterdrückende Ideologie bestärkt, die eine Hauptursache vieler Sexualstörungen ist. Viele Therapeuten verbringen Wochen damit, ihren Patienten sexuelle Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen und helfen ihnen, einen zu engen Begriff des Geschlechtsverkehrs auszuweiten, das heißt den ganzen Körper in die Interaktion einzubeziehen. Deshalb sind ja auch gerade die sogenannten „sensate focus"-Übungen entwickelt worden. Tatsächlich sind solche, betont nicht-genitale Berührungen oft das erste Mittel, die gestörte Sexualfunktion wiederherzustellen und so indirekt auch den Koitus wieder zu ermöglichen. Man kann daher mit gutem Grund sagen, dass die heutigen sexualtherapeutischen Übungen in ihrer Gesamtheit klar zeigen, woran es beim modernen „Geschlechtsverkehr" fehlt - er ist zur rein genitalen Interaktion verkümmert und somit auf dem Weg zur Funktionsstörung. Ganz allgemein kann man sagen, dass der „Fetisch Genitalität" die menschlichen Sexualbeziehungen heute in dreifacher Weise verzerrt. So finden wir • eine Überbetonung der männlichen sexuellen Initiative (auf Kosten der weiblichen Initiative), • eine Überbetonung des Koitus (auf Kosten anderer Formen des Geschlechtsverkehrs), • eine Überbetonung des Orgasmus (auf Kosten verspielter Zärtlichkeit oder des langsamen sinnlichen Genusses). Die heutige Sexualtherapie versucht, die verlorene Balance wiederherzustellen, fällt aber durch ihre unreflektierte Fachsprache doch oft in die alte Ideologie zurück. Das ist auch immer der Fall, wenn Therapeuten vom Koitus als dem „Geschlechtsakt" sprechen oder wenn sie Ausdrücke wie „Petting" oder gar „Vorspiel" gebrauchen und sie vom „eigentlichen Verkehr" unterscheiden. Damit wird eine schädliche Zielorientierung suggeriert, die sexuelle Begegnung in Akte, Kapitel oder eskalierende Phasen eingeteilt, wo doch eine Verlaufsorientierung an zwangloser Kontinuität und Spielfreude sehr viel heilsamer wäre. In der unausgesprochen vorgenommenen Abwertung von manuellem Verkehr und Oralverkehr spielen sicher auch noch alte religiöse Tabus eine Rolle. Dass diese traditionelle Fixierung auf den Koitus eine religiöse Seite hat, wird ja auch daran deutlich, dass nichtkoitale Formen des Geschlechtsverkehrs lange als „Perversionen", „Aberrationen" oder „Deviationen" etikettiert wurden. Diese Ausdrücke stammen aus der mittelalterlichen Theologie und bezeichneten ursprünglich Häresien, das heißt Formen des falschen Glaubens. Sie wurden im Laufe des vorigen Jahrhunderts von der Psychiatrie aufgegriffen und verweltlicht, ein Verfahren, das man auch die „Medikalisierung der Sünden" genannt hat. In der Tat sah die damalige Medizin, wie die Kirche, ganz naiv im Koitus das einzig korrekte und normale Sexualverhalten, das, sozusagen tief in der Natur des Menschen angelegt, nach der Pubertät spontan zum Ausdruck drängte. Diese vorwissenschaftliche Chimäre eines einzigen „natürlichen" Geschlechtsaktes spukt selbst heute noch durch die psychiatrische Literatur, wenn auch oft in sehr verblasster und verwaschener Form. Wo die alten theologischen Begriffe selbst noch erscheinen, werden sie nun gewöhnlich mit vielen Einschränkungen umgeben, etwa der, dass das Wort „Perversion" kein moralisches Urteil bedeute, oder dass eine „Deviation" nicht unbedingt krankhaft sein müsse, Solche gutgemeinten Abschwächungen lösen aber das eigentliche ideologische Problem nicht und stiften nur weitere Verwirrung. Die Gefahr der Verdinglichung Das alte System der „sexuellen Psychopathien" war aber nicht einfach nur eine Codifizierung moralischer Vorurteile. Die oft phantastischen Namen der „Perversionen" oder „Deviationen", von der Algolagnie über die Gerontophilie und den Pygmalionismus zur Zooerastie, hatten von jeher noch eine weitere Schwäche: Sie erweckten den Eindruck, man habe es hier mit klar abgrenzbaren, einheitlichen klinischen „Krankheitsbildern" zu tun, das heißt mit echten Diagnosen und entsprechend feststehender Ätiologie und Therapie. In Wirklichkeit aber sagten diese exotischen Bezeichnungen so gut wie nichts darüber aus. Sie waren nicht mehr als griechisch und lateinisch verfremdete Schimpfwörter. Ihr wissenschaftlicher Aussagewert war gewöhnlich gleich Null, und so musste sich erst eine neue, eigenständige „Sexualwissenschaft" heranbilden, die den Phänomenen unvoreingenommen nachging. Wie Iwan Bloch, der Begründer dieser Wissenschaft, schon 1912 schrieb: „Die Sexualwissenschaft. . . (darf) nicht als Anhängsel irgendeiner anderen Wissenschaft aufgefasst werden . . . Wohin das führen würde, hat die rein medizinisch-klinische Betrachtungsweise von Krafft-Ebings .... seiner Vorgänger und Nachfolger gezeigt, unter denen manche schon die Wissenschaft bereichert zu haben glauben, wenn sie neue Spezialfremdwörter ohne begrifflichen Inhalt bilden, während es doch gerade hier vor allem auf die kritische Untersuchung der tatsächlichen Vorgänge ankommt." Die Gefahr der leeren Begriffsbildung besteht aber auch heute weiter. „Die kritische Untersuchung der tatsächlichen Vorgänge" hat nun zwar, dank der Sexualwissenschaft, große Fortschritte gemacht, aber diese haben sich noch nicht überall in der Fachterminologie niedergeschlagen. Während die Forschung flexibler wurde und immer weiter differenzierte, blieb die Therapie weitgehend in dem überkommenen Begriffsapparat befangen. Daraus ergibt sich eine zunehmende Spannung zwischen neuer wissenschaftlicher Einsicht und sprachlicher Routine. Das Problem besteht aber nicht etwa nur in Ungenauigkeiten oder versteckter ideologischer Wertung, sondern sitzt teilweise sehr viel tiefer. Was damit gemeint ist, könnte man vielleicht als das Problem der Verdinglichung bezeichnen. Das heißt, es besteht in unserem Denken eine unheilvolle Tendenz, Beobachtungen von Vorgängen in „Dinge" zu verwandeln. Diese Tendenz ist in anderen Kulturen und Sprachen weniger stark ausgeprägt. In den semitischen Sprachen und im klassischen Japanischen zum Beispiel ist das Verb vorherrschend, während in den indo-europäischen Sprachen das Substantiv zumindest gleiches Gewicht hat. Schon in der griechischen Philosophie spielt das Substantiv eine größere Rolle als das Verb, und diese philosophische Erbe verleitet uns dazu, die Wirklichkeit als eine Kollektion von abgegrenzten Wesenseinheiten aufzufassen. Genaugenommen ist diese Sicht aber „unrealistisch", da sie der Vielfältigkeit menschlicher Erfahrungen nicht gerecht wird. Auf die sexuelle Erfahrung angewandt, heißt das, dass keine therapeutische Sprache wirklich adäquat sein kann, solang sie sich an Substantive klammert. Die Vorstellung von unabhängig existierenden Einheiten wie Alibidinie, Algopareunie, Anorgasmie usw. ist kurzsichtig. Es handelt sich nicht um freischwebende „Krankheitswesen", die plötzlich gewisse Personen befallen, während sie andere verschonen. Krankheiten und Sexualstörungen haben kein eigenes Leben. Sie existieren nur als vorübergehende Teilattribute von Personen, das heißt sie sind eigentlich noch nicht einmal Attribute im Sinn von Substantiven, sondern nur im Sinn von Adjektiven. Man behandelt daher niemals Sexualstörungen, sondern immer nur Personen, die sexuell gestört sind. Kurz gesagt, es gibt keinen Vaginismus und keine Anorgasmie, sondern nur Individuen mit bestimmten problematischen Attributen, die möglicherweise nicht von Dauer sind. Aber selbst mit dieser Feststellung muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man zum Beispiel eine Frau als „anorgasmisch" bezeichnet, so darf man nicht vergessen, dass dieses Attribut sie nicht als ganze Person definiert, sondern nur in einem begrenzten Verhaltenszusammenhang relevant ist. Das gilt natürlich auch für Adjektive wie „sadistisch", „masochistisch", „transvestitisch" und „homosexuell". Es ist ein großer wissenschaftlicher, aber auch therapeutischer Fehler, diese begrenzten Attribute zu verabsolutieren und zu selbständigen Wesenseinheiten aufzublasen. Gewissenhafte Forscher vermeiden dies, wie zum Beispiel Alfred C. Kinsey, der sich sehr bewusst weigerte, das Substantiv „Homosexueller" zur Bezeichnung von Personen zu gebrauchen. Kinsey erkannte eben deutlich, dass ein solcher Sprachgebrauch nicht nur bestimmte Personen ihrer vollen Humanität beraubt, sondern auch sachlich irreführend ist. Was endlich das Gebiet der Medizin und Hygiene betrifft, so hat man schon vor längerer Zeit vermutet, dass der nächste große Fortschritt darin bestehen wird, Krankheiten nicht mehr als Substantive, sondern als Adjektive aufzufassen. Dieser Fortschritt hat heute schon begonnen, und so dürfen wir hoffen, dass er bald auch in der Sexualtherapie fühlbar wird. |